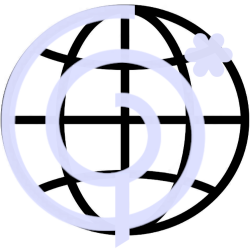Besonders Personen in ohnehin prekären Lebenslagen wird zurzeit ständig vorgehalten, sie kosteten zu viel – als Gepflegte1Simone Schmollack: Pflegegrad 1 soll abgeschafft werden. Dann müssen (wieder) die Frauen ran, die tageszeitung, 03.10.2025, https://taz.de/Pflegegrad-1-soll-abgeschafft-werden/!6114959/; Elisabeth Hussendörfer (Interview mit Ajla Crnalic): Pflegegrad 1 zusammenstreichen? „Dann wird es in Häusern öfter anfangen zu stinken“, FOCUS online, 15.10.2025, https://www.focus.de/politik/pflegegrad-1-abschaffen-dann-wird-es-in-haeusern-oefter-anfangen-zu-stinken_16c7d84d-1c09-4893-92bd-00474ca9ca62.html; „Putzen ist keine Physiotherapie“ – Patientenschützer empört über Haushaltshilfe-Debatte (KNA/krö), Welt, 08.11.2025, https://www.welt.de/politik/deutschland/article690f38622e71575527eee078/fuer-pflegegrad-1-putzen-ist-keine-physiotherapie-patientenschuetzer-empoert-ueber-haushaltshilfe-debatte.html., Menschen mit Behinderung2Carmen Mörwald: Merz nach Aussage unter Beschuss: „Schlag ins Gesicht für Menschen mit Behinderung“, Frankfurter Rundschau, 27.06.2026, https://www.fr.de/verbraucher/merz-nach-aussage-unter-beschuss-schlag-ins-gesicht-fuer-menschen-mit-behinderung-93804685.html; Katja Thorwarth (Interview mit Beata Ackermann): „Grundrechte der Menschen werden zum Kostenfaktor und Luxusgut“, Frankfurter Rundschau, 19.12.2025, https://www.fr.de/politik/grundrechte-der-menschen-werden-zum-kostenfaktor-und-luxusgut-94088721.html., Bezieher*innen von Bürgergeld3Neue Grundsicherung: Sozialverbände warnen vor Wohnungslosigkeit durch Bürgergeldreform (DIE ZEIT, KNA, epd, ljk), DIE ZEIT, 21.10.2025, https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-10/buergergeld-reform-grundsicherung-sozial-offener-brief; Rainer Rutz/David Hinzmann: Abschaffung des Bürgergelds. Noch mehr Härten, noch mehr Demütigungen, die tageszeitung, 15.01.2026, https://taz.de/Abschaffung-des-Buergergelds/!6145563/. (demnächst Grundsicherungsgeld), dabei besonders Migrant*innen aus Südosteuropa4Stolipinovo in Europa e. V./Netzwerk Europa in Bewegung: Offener Brief an Bundesministerin Bärbel Bas, Stolipinovo in Europa, 27.10.2025, https://stolipinovoeuropa.org/wp-content/uploads/2025/10/Offener-Brief-Baerbel-Bas-EU-Migration-271025.pdf; ak-Redaktion: »Wir fordern Sie auf, den Blick umzudrehen«, analyse & kritik, 18.11.2025, https://www.akweb.de/bewegung/die-buergergeld-debatte-ist-rassistisch-und-antiziganistisch/., Rentner*innen5Ulrike Hermann: Der doppelte Irrtum der Jungen Union. Renten lassen sich nicht kürzen, die tageszeitung, 16.11.2025, https://taz.de/Der-doppelte-Irrtum-der-Jungen-Union/!6126226/; CDU-Wirtschaftsrat fordert Steuersenkungen und weniger Sozialausgaben (DIE ZEIT, Reuters, AFP, sbo), DIE ZEIT, 01.02.2026, https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-02/wirtschaftsrat-cdu-agenda-fuer-arbeitnehmer-gxe.… – sie seien zu faul, bequem und anspruchsvoll. Kanzler Merz‘ Beschwerde über die telefonische Krankmeldung bzw. den Krankenstand (hauptsächlich durch die jetzt vollständigere elektronische Erfassung erhöht)6Astrid Halder: Telefonische Krankschreibungen schuld an hohem Krankenstand?, BR24, 21.01.2026,https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/streit-um-telefonische-krankschreibung-chance-fuer-blaumacher-oder-nicht-wer-hat-recht,V8x3Iz1. folgte die angebliche Lifestyle-Teilzeit: Nur Beschäftigten mit besonderer Begründung, wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder Weiterbildung, sollte dem CDU-Wirtschaftsflügel zufolge Teilzeitarbeit künftig genehmigt werden.7Meike Föckersperger/Arno Trümper: Teilzeitdebatte: „Das hat nichts mit Lifestyle zu tun“, BR24, 27.01.2026, https://www.br.de/nachrichten/bayern/lifestyle-teilzeit-empoerung-ueber-cdu-vorstoss,V9UirF3; Julia Hanigk: „Es wird einen Grund haben“: Teilzeit-Debatte trifft auf harsche Kritik, Frankfurter Rundschau, 30.01.2026,https://www.fr.de/wirtschaft/es-wird-einen-grund-haben-teilzeit-debatte-trifft-auf-harsche-kritik-zr-94147573.html. Müssen unbezahlt Care-Arbeitende dann demnächst eine Befreiung von der Vollzeitpflicht beantragen und muss dazu die Verwandtschaft mit den Betreuten nachgewiesen werden? Es könnte sich schließlich (verwerflicherweise) nicht einmal um die eigene handeln, sondern die von Lebenspartner*in, Freund*in, … .
„Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können“, hatte Bundeskanzler Merz letztes Jahr längst Vorarbeit geleistet.8Merz kritisiert Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance: „Wir müssen in diesem Land wieder mehr arbeiten“ (dpa), Tagesspiegel, 14.05.2025, https://www.tagesspiegel.de/politik/merz-kritisiert-vier-tage-woche-und-work-life-balance-wir-mussen-in-diesem-land-wieder-mehr-arbeiten-13687588.html. Obwohl schon in Hard Times, einem Roman von 1854, Schriftsteller Charles Dickens an ähnlichen Vorstellungen kein gutes Haar ließ: Cili, Tochter eines armen alleinerziehenden Zirkusartisten, beantwortet dort die Frage ihres Schullehrers, ob eine Nation, die „an Geld fünfzig Millionen“ besitze, denn nicht glücklich sei, sie könne das nicht wissen, „bis ich wüßte, wer denn eigentlich das Geld hätte und ob etwas davon mein wäre“.9Charles Dickens: Schwere Zeiten (übersetzt von Carl Kolb), Projekt Gutenberg, https://projekt-gutenberg.org/authors/charles-dickens/books/schwere-zeiten/chapter/11/. Also, wessen Wohlstand?

„Die Feminisierung von Armut steht außer Frage“, schrieb in der analyse & kritik Hêlîn Dirik. „[…] Frauen werden oft unter- oder gar nicht bezahlt, sind häufiger prekär und atypisch beschäftigt und besonders von Altersarmut bedroht.“10Hêlîn Dirik: Geächtet, dämonisiert, mittellos, analyse & kritik, 18.06.2024, https://www.akweb.de/ausgaben/705/geaechtet-daemonisiert-mittellos-frauen-und-queers-leben-oft-in-armut/. Das Wirtschaftscredo lautet zwar, alle sollten und könnten sich in gleicher Weise durch Erwerbsarbeit erhalten, aber tatsächlich sind Ungleichheiten – wie Geschlechterungleichheit einschließlich geschlechtlicher Aufgabenzuschreibung – gerade unter neoliberalen Bedingungen Profitressourcen: Zum Beispiel werden jährlich zig Milliarden Stunden an unentlohnter Care-Arbeit vor allem von Frauen* geleistet.11MDR Aktuell: Frauen leisten jährlich 72 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit, MDR, 28.02.2024, https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/care-arbeit-frauen-haushalt-familie-verteilung-100.html; Pressemitteilung: Neue Studie des WSI: Erwerbstätige Frauen leisten im Mittel acht Stunden mehr unbezahlte Arbeit pro Woche als Männer, Hans-Böckler-Stiftung, 05.09.2024, https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-erwerbstaetige-frauen-leisten-mehr-unbezahlte-arbeit-als-maenner-63173.htm.
„Täglich mehr Zumutungen“ weiterlesen