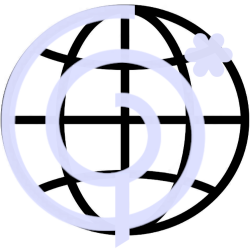Hunderte von Frauen* versammelten sich Freitag letzter Woche in mehreren Städten Südafrikas, um am Vorabend des G20-Gipfels in Johannesburg am Wochenende gegen Geschlechtergewalt und Femizide zu demonstrieren. Die Teilnehmerinnen* der Aktion – unter anderem in Johannesburg, Pretoria, Kapstadt und Durban – waren als Zeichen von „Trauer und Widerstand” schwarz gekleidet und veranstalteten einen 15-minütigen liegenden Schweigeprotest, der die fünfzehn täglich durch geschlechtsbezogene Gewalt im Land Getöteten symbolisieren sollte. Südafrika hat eine der höchsten Femizidraten weltweit.

Aufgerufen worden war zu den G20 Women’s Shutdown genannten Protesten von der Organisation Women for Change, die die südafrikanischen Frauen* und LGBTQ+-Communities für den Tag ebenfalls zu einem Streik aufforderte, also dazu, „alle bezahlten und unbezahlten Arbeiten an Arbeitsplätzen, Universitäten und zu Hause ruhen zu lassen und den ganzen Tag lang kein Geld auszugeben, um die ökonomischen und sozialen Auswirkungen ihrer Abwesenheit zu demonstrieren“.
„Südafrika: Protest gegen Femizide zum G20“ weiterlesen