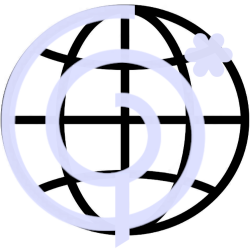In Lomé, der Hauptstadt Togos – zu der Zeit nominell Völkerbund-Mandatsgebiet unter französischer Verwaltung, de facto eine französische Kolonie, – rebellierten am 24. und 25. Januar 1933 (es ist also gerade 92 Jahre her) die Markthändlerinnen*, nachdem der französische Commissaire de la République Robert de Guise die Einführung neuer Steuern bekanntgegeben hatte.
Neben der Verwaltung Frankreichs mit dem Commissaire an der Spitze bestanden damals in Lomé zwei ausschließlich männliche togoische Vertretungen, der Conseil des Notables (Franz.: Rat der Notabeln) und die Duawo (Ewe: Bevölkerung, Leute). Im Gegensatz zum Conseil, den 1922 die französische Verwaltung ins Leben gerufen hatte, galten die Duawo – eine Initiative von Männern, die jünger, weniger gut gestellt waren – als nicht durch die Zusammenarbeit mit der Kolonialmacht kompromittiert. So oder so wandten sich beide Gruppen in der Situation, in der die Weltwirtschaftskrise auch in Togo die Bevölkerung hart getroffen hatte, schriftlich an Commissaire de Guise und wiesen auf das drohende Elend durch eine höhere Besteuerung hin.
Doussi Ekué Attognon, Markthändlerin und Beteiligte an den späteren Protesten, erzählte 1977 (im Alter von 79 Jahren) über ihre Steuerfestsetzung: „Eines Morgens, als ich auf den Markt gehen wollte, kamen zwei Steuerbeamte zu mir. Sie zählten, wie viele Hühner, Enten, Hocker und Tische ich hatte; sie schätzten die Menge an Bonbons, Streichhölzern und importierten Seifen, die ich auf ein Tablett gelegt hatte, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Sie fragten mich, ob ich verheiratet sei. Ich bejahte … Dann wollten sie wissen, ob ich mit ihm zusammenlebe. Angesichts einer so unverschämten Frage schwieg ich. Danach berieten sie sich, kritzelten etwas auf einen Zettel und sagten zu mir: ‚Sie werden dieses Jahr 70 Franc Steuern zahlen.‘ Ich wollte wissen, ob die Marktgebühren in dieser Berechnung enthalten seien, aber sie sagten nein.“
Der Commissaire de la République de Guise verweigerte die Rücknahme der Besteuerung; gleichzeitig hielt er die Duawo für Unruhestifter, weil er deren Zusammenschluss als unrechtmäßig betrachtete und sie zudem die Bevölkerung öffentlich über die Steuern informiert hatten. Am Morgen des 24. Januar 1933 nahm die Polizei zwei der führenden Köpfe fest, Kobina Garthey und Michel Johnson. Diese Inhaftierung wurde der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und löste eine Revolte aus, die am Nachmittag des Tages ausbrach.
Doussi Ekué Attognon berichtete, wie die Nachricht von der Festnahme auf dem Markt dazu führte, dass die Händlerinnen* den Protest selbst in die Hand nahmen. Schon länger hatten die Marktfrauen* Probleme mit der französischen Verwaltung, die die Marktstandorte kontollieren und die Markttage begrenzen wollte.
„Der gesamte Markt kochte vor Wut. Wir räumten eilig unsere Sachen zusammen. Parolen machten die Runde. ‚Alle Frauen zum Gefängnis!‘ Andere sagten: ‚Gehen wir zum Kommandanten!‘ Aber das Gefängnis und das Büro des Kreiskommandanten waren am selben Ort, nämlich dort, wo heute die École de la Marina ist. … Wir sangen Anzüglichkeiten über die Franzosen, die eine oder andere von uns stimmte ein Kriegslied an, das wir im Chor sangen; es wurde viel improvisiert. Das erfolgreichste Lied war das über ‚Allaga‘; Allaga war ein Adept des Blitzgottes Hébiésso. Der Tag, an dem Allaga mit Palmzweigen bekleidet hervortrat, war ein Tag der Rache Hébiéssos. Heute sind wir Allaga und müssen die Beleidigung der Franzosen rächen. Im Rhythmus der Lieder schüttelten wir die Palmwedel, die wir hatten. … Vom Gefängnis aus gingen wir zum Regierungspalast. In der Umgebung und in den Gärten riefen wir lauthals die Namen Garthey und Johnson.“
Eine Menge von drei- bis fünftausend Personen, in der 80 Prozent weiblich waren, sammelte sich um den Regierungspalast. Nachdem Steinwürfe die Fenster getroffen hatten, wurde mit Platzpatronen in die Luft geschossen und „[d]as Militär drängte uns zurück. Einige verhöhnten sie mit den Worten: ‚Ihr habt nur Luft in euren Gewehren‘, …“ Commissaire de Guise veranlasste schließlich die Freilassung der beiden Duawo-Anführer.
An diesem Abend wurde auch das Haus von Jonathan Savi de Tové attackiert, dem Secrétaire des Conseil des Notables, weil ihm Komplizenschaft mit der französischen Regierung vorgeworfen wurde. „Die Voodoo-Priesterinnen, die aus Bè gekommen waren, um sich der Bewegung anzuschließen, schleiften ihre Hintern über den Boden seines Hofs, um ihn zu verfluchen, und sein Brunnen wurde mit Müll zugeschüttet.“
„Am nächsten Tag, einem Markttag, wurden morgens die Demonstrationen wieder aufgenommen. Niemand war auf dem Markt. Nachdem Garthey und Johnson freigelassen worden waren, verlangten wir jetzt die Abschaffung der Marktgebühren und Aufhebung der neuen Steuern.“
Der britische Vizekonsul George Howells beschrieb, dass sich die Protestierenden hauptsächlich aus den unteren Schichten zusammensetzten, aus Bäuerinnen*Bauern aus den Außenbezirken der Stadt, Marktfrauen*, männlichen Jugendlichen, und kaum Angehörige der besseren Schichten beteiligt waren. Der Bahnhof, Fernmeldeämter, das Zollamt und der Kai wurden von einer großen Gruppe Jugendlicher angegriffen. Als Commissaire de Guise die Nachricht erhielt, dass sich eine mit Messern und Knüppeln bewaffnete Menge auf das Zentrum zubewege, wies er den Stadtkommandanten an, die Aussetzung der neuen Steuern zu verkünden. Schon nachmittags hatte sich Lomé mehrheitlich beruhigt.
Dennoch ließ die Repression nicht auf sich warten. Verstärkung wurde angefordert und aus Côte d’Ivoire eingetroffene Truppen gingen hart gegen die Bevölkerung vor – Flucht ins Exil, Festnahmen, Haftstrafen, Vergewaltigungen und Tötungen (im Viertel Hanoukopé) waren die Folge. Nachdem die Toten beerdigt waren, schlossen sich aus der gesamten Stadt Frauen* mit den Priesterinnen* der Randgemeinde Bè zu einer traditionellen Reinigungszeremonie zusammen.
Über die Militärgewalt hinaus wurden später ganze Stadtbezirke verurteilt, gemeinschaftlich Tausende von Franc Strafe zu zahlen und Zwangsarbeit zu leisten.
Mittlerweile gilt der Aufruhr allgemein als Beginn eines antikolonialen togoischen Selbstbewusstseins und erstes Anzeichen einer entstehenden Unabhängigkeitsbewegung. Gleichzeitig war darin die – angesichts der Unfähigkeit konkurrierender männlicher Machtgruppen – deutliche Entschlossenheit der Frauen*, ihre Rechte und Interessen bzw. die der Bevölkerung zu schützen, entscheidend für den (wenn auch durch die Repression bitteren) Protesterfolg. Auch wenn die Marktfrauen* und andere Frauen* wie die Voodoo-Priesterinnen* damals nicht über eine formelle politische Organisation verfügten, bildeten sie ein wirtschaftliches und soziales Netzwerk in der Stadt und darüber hinaus, z. B. auch als grenzüberschreitende Händlerinnen*, und nutzten in der Revolte unter anderem traditionelle kulturelle Praktiken, um eine eigene Autorität zu beanspruchen.
Quellen:
Silivi d’Almeida-Ekué: La révolte des Loméennes, 24-25 janvier 1933. Lomé, 1992 (insbesondere stammen alle Zitate von Doussi Ekué Attognon daraus, S. 82 ff.),
African Feminist Forum: Market Women of Lomé. African feminist ancestors, https://www.africanfeministforum.com/market-women-of-lome-togo/, bzw. Le marché des femmes de Lomé. Ancêtres féministes africaines, https://www.africanfeministforum.com/fr/market-women-of-lome-togo/,
Benjamin N. Lawrance: Locality, Mobility, and “Nation”: Periurban Colonialism in Togo’s Eweland, 1900-1960, Rochester, 2007.